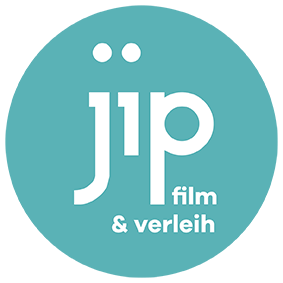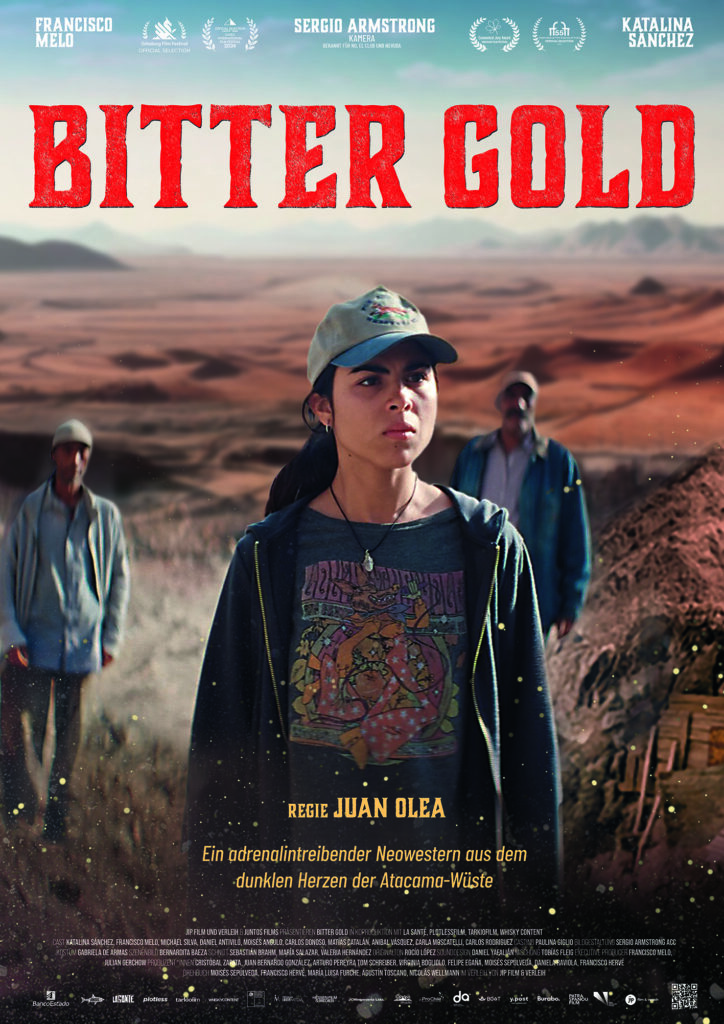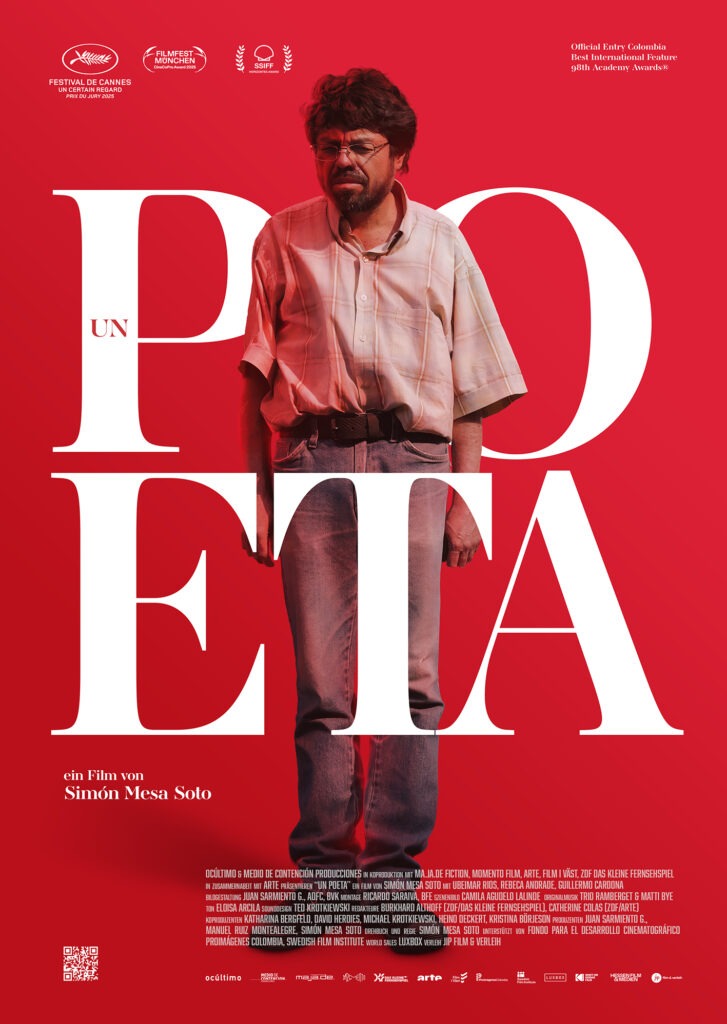Eine Reise über das Meer und durch die Zeit: Vier Schiffe der einst größten DDR-Fischereiflotte haben die Wende überdauert und fahren heute unter anderer Flagge, in neuen Gewässern. Sie erzählen von Arbeit, Gemeinschaft und Heimat und der Frage, was davon bis heute geblieben ist.
VOM TRAUM, UNSINKBAR ZU SEIN
Ein Heimatfilm auf dem Meer erzählt von Charly Hübner.
Demnächst im Kino
Die Geschichte

In VOM TRAUM, UNSINKBAR ZU SEIN erzählt der Rostocker Regisseur Tom Fröhlich eine Heimatgeschichte auf dem Meer. In ihrer Blütezeit umfasste die Flotte der DDR-Hochseefischer(ei) über 100 Schiffe – die größte die je unter deutscher Flagge fuhr. In 40 Jahren Großrederei ging kein einziges Schiff auf See verloren. Heute existieren nur noch wenige dieser stählernen Kolosse. Vier von ihnen hat Tom Fröhlich aufgespürt: Vor Grönland, in einem spanischen Hafen, auf einem dänischen Schrottplatz und im Hamburger Hafen. Sie sind die letzten Zeugen einer untergegangenen Arbeitswelt und zugleich lebendige Orte, an denen auch heute noch gearbeitet, gelebt und erinnert wird. Erzählt von Charly Hübner.
Der Film thematisiert die Auswirkungen von Wende, Globalisierung und Industrialisierung – zugleich ist er eine vielschichtige Reflexion über Erinnerung, Heimat und den schmerzhaften Verlust in einer sich stetig wandelnden Welt.
Sonderveranstaltungen
 Tom Fröhlich, (*1989) ist in der Hansestadt Rostock aufgewachsen. Nach einer Berufsausbildung zum Mediengestalter studierte er an der h_da Darmstadt (Motion Pictures) und der Filmuniversität Konrad Wolf (Regie).
Tom Fröhlich, (*1989) ist in der Hansestadt Rostock aufgewachsen. Nach einer Berufsausbildung zum Mediengestalter studierte er an der h_da Darmstadt (Motion Pictures) und der Filmuniversität Konrad Wolf (Regie).
Zu seinen Arbeiten gehören national und international ausgezeichnete Dokumentarfilme und Dokumentationen sowie Doku-Serien. Sein Debütfilm „Ink of Yam“, über ein Tattoostudio in Jerusalem, wurde 2017 mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet. Für „Das perfekte Schwarz“ (2019) begleitete Tom Fröhlich 6 Menschen auf der Suche nach der Vielfalt im Nichts. Der Film wurde bei den Hofer Filmtagen uraufgeführt und feierte seine internationale Premiere bei der CPH:dox in Kopenhagen. „Vom Traum unsinkbar zu sein“ ist Tom Fröhlichs dritter Kino-Dokumentarfilm über die Suche nach den letzten Schiffen der DDR-Hochseefischerei. Tom Fröhlich lebt und arbeitet in Leipzig und Potsdam.
FILMOGRAFIE (Auswahl)
2023 DIE MILLIARDEN DER ANDEREN (TV Dokumentation)
2020 DAS PERFEKTE SCHWARZ – Weltpremiere CPH:DOX 2020
2020 TREUHAND – EIN DEUTSCHES DRAMA (TV Dokumentation)
2017 INK OF YAM – Weltpremiere Dokfest München 2018
DIRECTOR’S NOTE
Als ich ein Kind war, in der Nachwendezeit, fuhr mein Vater mit mir in den Rostocker Überseehafen: Schiffe gucken. Ich liebe das Gefühl bis heute, wenn ein Schiff ablegt: Es fühlt sich so an, als würde das Schiff stehen bleiben und man selbst wegtreiben. Als „Rostocker Jung“ war in mir angelegt, was viele Menschen kennen, die am Meer groß werden: Schiffe, Wasser, Wind und Wellen. Der Proberaum meiner Jugendband war nur einen Steinwurf vom Fischereihafen entfernt. Meine Freunde spielten damals Fußball bei „FiKo“ Rostock – Fischereikombinat. Ich bin sicher, keiner von uns wusste, was diese Wörter bedeuteten, obwohl wir sie alle kannten.
Wir wussten nicht, dass diese Namen Synonyme waren für 10tausende Menschen, die ihre ganze Identität an einen Betrieb koppelten, der versuchte, so viel Fisch wie möglich in die DDR zu bringen. Das Fischkombinat ist, wie viele andere Betriebe in den neuen Bundesländern, irgendwie verschwunden – und in der Ambivalenz der Geschichte scheint es schwer sich richtig oder falsch zu erinnern. Also vergisst man. Wer heute einen Menschen unter 30 in meiner Heimatstadt fragt, was das Fischkombinat war – ich bin sicher er würde keine Antwort bekommen.
Ich war 2014 auf den ersten Stammtischen der alten DDR-Hochseefischer. Große Treffen, zum Teil mit mehreren 100 Personen – von Waren über Weimar nach Dresden und Augsburg. Überall trafen sich die alten Matrosen, Kapitäne und Produktionsarbeiter. Ich lernte Menschen kennen, die unisono behaupteten, ihre besten Jahre auf See verbracht zu haben, bevor die Wiedervereinigung sie zwang an Land zu bleiben. So beschworen sie also alle paar Monate bei ihren Treffen die alten Kollektive, die harte Arbeit, (die heute sowieso keiner mehr schaffen würde), das Gefühl auf dem Meer zu sein und vor allem ihre zweite Heimat: Ihre Schiffe. Und so groß der Schmerz darüber all das verloren zu haben: Am meisten kränkt sie, dass man ihnen ihr zweites Zuhause genommen hatte: Ihre Kojen, Maschinenräume, Messen und Brücken. „Wir haben auf See nie ein Schiff verloren“. Diesen Satz hörte ich bei jedem der Treffen – gefolgt von der Erzählung, dass sie nach der Wiedervereinigung eben jene verloren hatten. Ihre Schiffe wurden überwiegend verschrottet, ein paar verkauft und einzelne verblieben in einem Rostocker Nachfolgebetrieb.
Also begann ich die verbliebenen Schiffe zu suchen und fand vier, deren Schicksal in „Vom Traum unsinkbar zu sein“ erzählt wird. Ich war fünf Wochen im europäischen Nordmeer, in spanischen Polizeihäfen, auf Partys im Hamburger Hafen und schließlich in einer dänischen Verschrottungswerft – und wenn ich eins gelernt habe, dann dass die Geschichten, der Schiffe hunderte Seiten füllen könnten, aber am Ende bleibt der Stahl und der Rost.
Das Fischkombinat ist für mich ein Symbol für den einen riesigen Arbeitgeber, der viele Orte in Deutschland prägte, Identitäten schliff und dann irgendwann verschwand. Egal ob Zeche, Fabrik oder Hafen. Die Aufgabe die Geschichten dieser Orte zu erzählen, liegt bei meiner Generation – denn die Zeugen schwinden. Ich könnte heute denselben Film nicht noch einmal drehen: Viele der alten Seeleute, die mir ihre Geschichten erzählten, sind längst verstorben, die Hälfte unserer begleiteten Schiffe verschrottet.
2025 Filmkunstfest Mecklenburg Vorpommern – Doppelpremiere
2025 DOK.fest München – Doppelpremiere
2025 Husumer Filmtage
2025 Nordische Filmtage Lübeck
2025 Kasseler Dokfest
Buch & Regie: Tom Fröhlich
Sprecher: Charly Hübner
Bildgestaltung: Michael “Midge” Throne, Anton Yaremchuk, Jörg Junge
Schnitt: Roland Possehl
Originalton: Tino Ammersdörfer, Christian Reiß
Komponistin: Friederike Bernhardt
Sounddesign: Moritz Busch, Roland Possehl
Mischung: Moritz Busch
Produktion: Roland Possehl, Wiebke Possehl (Populärfilm)
Koproduktion: Mitteldeutscher Rundfunk
Gefördert durch: Land Mecklenburg-Vorpommern, Kuratorium Junger Deutscher Film, Mitteldeutsche Medienförderung
Titel: VOM TRAUM, UNSINKBAR ZU SEIN – Ein Heimatfilm auf dem Meer
Genre: Dokumentarfilm
Jahr: 2025
Land: Deutschland
Laufzeit: 87 Minuten
Vorführformat: DCP, Farbe, 4k, Flat (1.90:1)
Ton: 5.1
Sprachfassung: Deutsch
FSK: tba
Demnächst im Kino
Sie möchten mit dem Film VOM TRAUM, UNSINKBAR ZU SEIN arbeiten?
Sie planen eine Fachveranstaltung oder ein Symposium?
Oder Sie überlegen eine Filmveranstaltung mit Freund*innen, Kolleg*innen etc. zu machen?
Wir unterstützen Sie!
Schreiben Sie uns einfach eine Mail an info@jip-film.de mit Telefonnummer.
Wir kontaktieren Sie umgehend.
Bei Interesse an einer Schulkinoveranstaltung können Sie sich entweder direkt an ein Kino in ihrer Nähe wenden oder Sie schreiben uns eine Email: info@jip-film.com oder rufen an: 069 – 805 322 73
Verleih und Dispo:
Jutta Feit
Hohenstaufenstr. 8
60327 Frankfurt am Main
Tel. 069 805 322 73
info@jip-film.de